Tim Engartner, Bildungsexperte aus Deutschland, beschreibt in diesem Buch die bildungspolitischen Problemfelder in der Bundesrepublik Deutschland. Das Gros dieser Kritikpunkte kann dabei 1:1 auch auf Österreich übertragen werden.
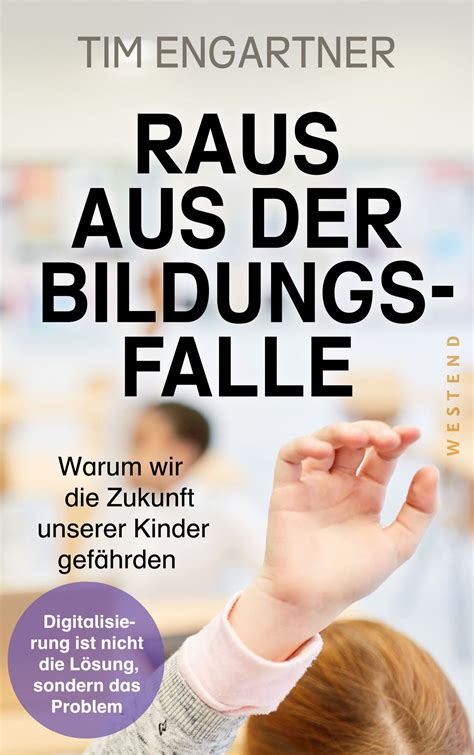
Engartner sieht in seinen Betrachtungen weniger das Bildungssystem per se (differenzierte Schule vs. Gesamtschule, Ganztagesschulen, Lehrpläne, …) als Problemfall, sondern vielmehr grundlegende Versäumnisse und Fehleinschätzungen:
- baufällige Schulen und mangelhafte Ausstattung
- zu wenige qualifizierte Lehrer sowie zu wenig Betreuungspersonal
- Wirrwarr bei den Zuständigkeiten zwischen Bund und Länder
- Nach-unten-Nivellierung des Leistungsniveaus
- Irrglaube, dass Technologie die Lösung aller Probleme sei
- digitale Abhängigkeit von Microsoft, Google und Apple
Dabei kritisiert Engartner auch den Trugschluss, dass etwa durch KI weniger Wissen notwendig sei, da dieses ja auf Knopfdruck immer und überall (nun auch nett zusammengefasst) abrufbar sein. Dabei wird oft vergessen, dass bei allerlei Hang zum kompetenzorientiertem Unterricht, Wissen auch weiterhin die Basis – das unabdingliche Fundament – darstellt.
[…] aber die Ausstattung der Schulen mit Smartboards, Tablets und WLAN wird uns nicht aus der Bildungsmisere führen. Dasselbe gilt für KI-gestützte Tools, denn auch ChatGPT und Co. werden uns nicht retten. Die modernen Neurowissenschaften belegen zweifelsfrei, dass analoge Lernprozesse unser Gedächtnis schulen. Somit ist zum Beispiel das Trainieren unseres Erinnerungsvermögens durch Auswendiglernen von herausragender Bedeutung, um die Wahrnehmungsgeschwindigkeit, die Memorierfähigkeit, das Kurzeitgedächtnis und die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses zu schulen.
Engartner setzt hier fort:
Vergessen scheint die Einsicht, dass Bildung nicht nur dem Vergnügen dient – zumindest dann nicht, wenn harte Brocken zu erarbeiten sind. Die Zufriedenheit folgt, wenn es geschafft ist. Sicherlich kann man Platons Höhlengleichnis, Immanuel Kants kategorischen Imperativ oder Jürgen Habermas‘ Diskurstheorie auch durch YouTube-Clips nachvollziehen. Doch das medial Dargestellte ist keineswegs nachhaltiger als das mehrfach Gelesene, mühsam Erarbeitete und im Unterricht Besprochene. Dasselbe gilt für die Inhalte, die das Kinderfernsehen mit Checker Tobi übermittelt. Sie können die analogen Lernprozesse in der Grundschule nicht ersetzen.
In Österreich ist man zum Glück in der Primarstufe davon abgekommen, den Unterricht zu sehr zu digitalisieren. Projekte wie der digi.case (https://dlpl.at/startseite) setzen hier vernünftig auf der analogen Seite an und ermöglichen erst in einem weiteren Schritt den Übergang auch ins Digitale.
In der Sekundarstufe setzt schön langsam ein leichter Abschwung der Technikeuphorie ein was sicher auch der Erkenntnis geschuldet ist, dass – wie es Engartner in seinem Untertitel des Buches auch formuliert – Digitalisierung nicht die Lösung für alles ist. Selbst im Mathematik-Unterricht zeigt sich bei allen Vorteilen einer dynamischen Geometriesoftware wie Geogebra, dass A) Basis-Verständnis auf analoger Seite verloren geht, B) die weiterführenden Bildungseinrichtungen in Österreich nach wie vor keinen Technologieeinsatz in der Mathematik prolongieren und C) auch Programme wie Geogebra rasch in eine Technologieabhängigkeit führen können (es sind nur Teile Open Source).
Dass sich das Bildungssystem für die Digitalisierung öffnen muss, steht außer Frage. Das WIE ist jedoch noch immer höchst umstritten. Das Pflichtfach Digitale Grundbildung in der Sekundarstufe I ist in Österreich sicher ein guter Ansatz, Schritt für Schritt digitale Kompetenzen im Alter von 10 bis 14 Jahren aufzubauen. Die frühe Ausstattung mit persönlichen Devices (Smartphone, Tablet, Laptop) zuerst durch die Eltern und nun auch durch die Schule ist in Anbetracht der vielen Risiken höchst kritisch zu betrachten.
Hier ist einmal mehr auf die Notwendigkeit eines digitalen Jugendschutzes hinzuweisen, welcher an eine funktionierende Altersverifikation gebunden ist und Dienste wie Social Media erst ab einem fortgeschrittenen und der kindlichen Entwicklung gerechten Alter (z.B. 16 Jahre) ermöglicht.
Lernen braucht Konzentration und Smartphones als Quell jeglicher Ablenkung sind der Feind eben dieser – diese Erkenntnis hat sich nun endlich eingestellt und immer mehr Schulen definieren Handy-freie Zonen und Zeiten. Klare Regeln braucht es aber nicht nur in der Schule sondern auch im Elternhaus und damit sind wir wieder bei der Forderung nach einem klaren, digitalen Jugendschutz angelangt damit digitale Tools auch tatsächlich als nutzbringendes Werkzeug verwendet werden.

0 Kommentare